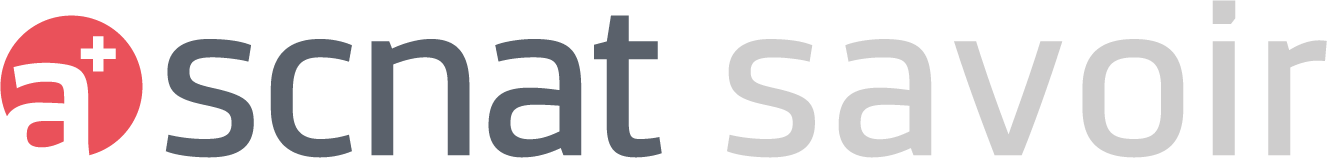Précipitations
Die Luft kann Wasserdampf aufnehmen. Wie viel Wasserdampf gehalten werden kann, hängt dabei von der Temperatur ab. Warme Luft kann mehr Wasserdampf speichern als kalte. Die relative Luftfeuchtigkeit zeigt an, wie viel Prozent der bei der momentanen Temperatur speicherbaren Menge Wasser in der Luft enthalten ist. Kühlt sich Luft ab, steigt also die relative Luftfeuchtigkeit, auch wenn die absolute Wassermenge gleich geblieben ist. Wenn die Luftfeuchtigkeit 100% beträgt, die Luft aber weiter abkühlt, wird sie übersättigt. Sie enthält also mehr Wasserdampf, als sie eigentlich halten kann. Dann kondensiert der überschüssige Wasserdampf und bildet Tropfen, die – wenn sie genug schwer sind – nach unten fallen.
Es gibt drei wichtige Prozesse, die zu einer Abkühlung der Luft und zur Niederschlagsbildung führen. Alle haben gemeinsam, dass die Luft aufsteigt und sich dadurch abkühlt:
- Trifft der Wind auf ein Gebirge, muss die Luft ausweichen und über das Gebirge steigen. Auf der Luvseite – wo der Wind herkommt – wird die Luft immer kälter. Wenn sie gesättigt ist und weiter aufsteigt, beginnt es zu regnen. Auf der Leeseite des Gebirges hingegen sinkt die Luft wieder ab. Es entsteht ein warmer und trockener Wind – der Föhn. Durch diesen Effekt fällt in hohen Lagen im Gebirge besonders viel Niederschlag. Täler wie das Wallis oder das Engadin, die zwischen zwei hohen Gebirgsketten liegen, befinden sich hingegen unabhängig von der Windrichtung im Windschatten und sind deshalb besonders niederschlagsarm.
- Gewitterzellen bilden sich, wenn sich die Luft über dem Boden lokal sehr stark erwärmt. Durch die Erwärmung wird die Luft leichter, sie steigt auf und kühlt dort ab. Durch die hohe Dynamik können Gewitter lokal begrenzt zu sehr starken Niederschlägen führen.
- Rund um grosse Tiefdrucksysteme entstehen Warm- und Kaltfronten. Bei Warmfronten schiebt sich die anströmende warme Luftmasse über die kältere, schwerere Luft. Beim Anstieg kühlt sie aus und es bildet sich Regen. Bei Kaltfronten geschieht genau das Gegenteil: Die anströmende kalte Luftmasse schiebt sich unter die wärmere Luft, die hier aufsteigt. Der Effekt bleibt gleich: es regnet.
Niederschläge sind ein zentraler Teil des Wasserkreislaufes. Sie bringen Wasser, das in der Landwirtschaft und in vielen anderen Bereichen unseres Lebens dringend benötigt wird. Wenn zu viel Regen fällt, kann sich dies auch negativ auswirken: Kurze, sehr extreme Niederschläge oder besonders langanhaltende Niederschläge können unsere Infrastruktur überfordern und zu Überschwemmungen und teuren Schäden führen.
Das gegenteilige Extrem – eine lange Trockenheit – kann sich zum Beispiel dann bilden, wenn ein stabiles und ausgeprägtes Hochdruckgebiet über Europa liegt. Dann gibt es kaum Wind, die Luftmassen bewegen sich nicht und der Regen bleibt aus. Wenn über einen langen Zeitraum kein oder nur sehr wenig Niederschlag fällt, spricht man von einer meteorologischen Trockenheit. Gewässer können (zum Beispiel aufgrund von Schneeschmelze) trotzdem noch Wasser führen. Erst wenn auch in den Gewässern unterdurchschnittlich viel Wasser fliesst, spricht man von einer hydrologischen Trockenheit.
Niederschlagsmessung
Niederschlag lässt sich punktuell sehr einfach bestimmen: Bereits ein Gefäss im Freien zeigt, wie viel Wasser sich nach dem Regen darin befindet. Es gibt sehr unterschiedliche Geräte, von einfachen Messzylindern an einem Stock bis hin zu komplexen Messsystemen mit Kippwagen und automatischer Datenübertragung. Das Messnetz in der Schweiz ist sehr dicht und einzelne Messreihen reichen mehrere Hundert Jahre zurück.

Um von diesen punktuellen Messungen den gesamten Niederschlag in einem Gebiet abzuschätzen, werden die Werte zwischen mehreren Stationen interpoliert. Dazu gibt es mehrere Methoden, die alle darauf basieren, dass man in der Nähe einer Station auch einen ähnlichen Niederschlag erwartet.
Das Problem an diesen punktuellen Messungen ist jedoch, dass Niederschläge lokal sehr unterschiedlich stark sind. Bei einem Gewitter kann es beispielsweise vorkommen, dass es stark regnet, während wenige hundert Meter weiter alles trocken bleibt. Auch nehmen die Niederschläge wie oben beschrieben mit der Höhe stark zu. Dazu kommt, dass die Niederschlagsmessungen vor allem bei viel Wind und bei Schneefall nicht besonders zuverlässig messen. Obwohl wir in der Schweiz also ein sehr gut ausgebautes Messnetz haben, ist die Abschätzung des gesamten Niederschlags in einem Gebiet also schwierig und mit Unsicherheiten behaftet.
Referenzen und weiterführende Literatur
November 2025, Basil Stocker, auf Basis des Berichts Wasser in der Schweiz – ein Überblick