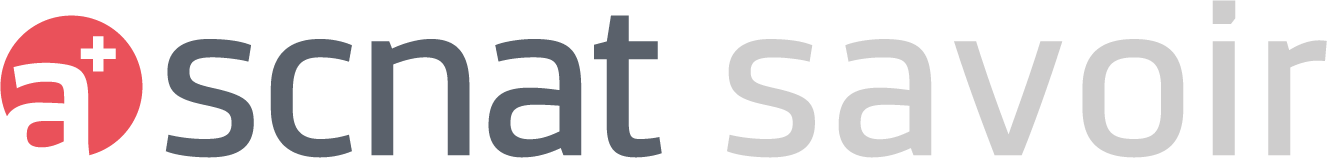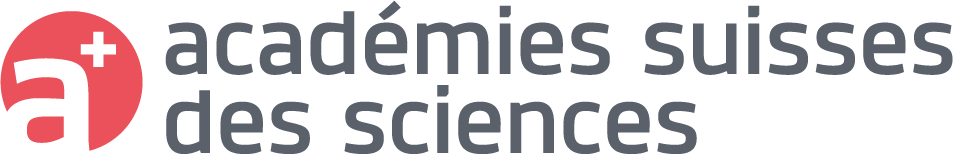Sujets correspondants
Un aperçu de l'histoire : Le 10e symposium sur l'adaptation
Le symposium « Adaptation au changement climatique » aura lieu pour la dixième fois le 28 novembre 2018. Un coup d'œil au tout premier événement de 1999 montre que les thèmes de l'époque sont toujours d'une grande actualité.
Image : ProClimProClim jette depuis 30 ans des ponts entre la science et la société
Depuis 30 ans, ProClim s’investit pour la recherche climatologique et pour le dialogue entre la science, la politique, l’économie, les médias et la société sur toutes les questions touchant au climat et au changement global. Fondé en 1988 par Hans Oeschger, Bruno Messerli et Kerry Kelts à titre de programme suisse de recherche sur le climat, ProClim s’est réorienté complètement en 1993, trouvant ainsi sa voie vers la réussite.
Image : ProClimDominoeffekt in den Alpen
Der Klimawandel kann die Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Ereignisketten erhöhen – von Kettenreaktionen also, wo ein Naturereignis ein nächstes auslöst. Solche Prozessketten, die aufgrund von Veränderungen im Hochgebirge ihren Anfang nehmen, können sich bis in Talregionen und ins Flachland auswirken.
Coup de projecteur sur le climat suisse
Depuis le milieu du XXe siècle, la surface terrestre se réchauffe dans des proportions exceptionnellement élevées – et nous savons pourquoi : avec les émissions de gaz à effet de serre, les humains sont les principaux responsables de la modification du bilan énergétique de la Terre. Or la Suisse réagit au changement climatique avec une sensibilité supérieure à la moyenne. Elle a donc tout intérêt à ce que la communauté mondiale adopte rapidement et largement une économie et un mode de vie neutres en CO2.
L’accord de Paris face au dernier obstacle en Suisse
La ratification de l’accord international des Nations Unies sur le climat (accord de Paris) est une étape importante sur la voie d’une protection du climat coordonnée à l’échelon mondial. Aujourd’hui, le Conseil des Etats discute cet accord et, s’il l’approuve, lui fera franchir en tant que second conseil le dernier obstacle du point de vue suisse. Un pas important, vu que la Suisse, selon le rapport « Coup de projecteur sur le climat suisse » publié par ProClim, de l’Académie des sciences naturelles, est particulièrement touchée par les changements climatiques.
Image : P. Blanc
L’accord de Paris réduira sensiblement les impacts climatiques en Suisse
Une action concertée au niveau mondial contre les changements climatiques est particulièrement importante pour la Suisse, car celle-ci est plus touchée qu’en moyenne par l’augmentation de la température. L’accord international des Nations Unies sur le climat, conclu en 2015 à Paris et dont le Conseil national discutera, demain jeudi, la ratification, pose la base d’une protection du climat coordonnée à l’échelon mondial. D’après le Forum ProClim de l’Académie suisse des sciences naturelles, des études scientifiques montrent qu’en Suisse, les impacts seront nettement plus faibles si l’objectif des deux degrés décidé à Paris est atteint que si le monde se réchauffe, par exemple, de trois degrés.
Image : Pixabay